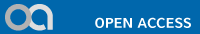Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit
Gute wissenschaftliche Praxis | Vorgaben der Fachdisziplinen | Literatur | Systematische Literaturrecherche | Rechtlicher Rahmen
Gute wissenschaftliche Praxis
Das Verfassen von wissenschaftlichen Publikationen gehört zum Prozess des wissenschaftlichen Arbeitens und unterliegt somit den Richtlinien zur Wahrung der guten wissenschaftlichen Praxis. Die LMU hat wie jede andere deutsche Universität ein Regelwerk zur guten wissenschaftlichen Praxis verabschiedet. Mitglieder der LMU müssen sich beim Abfassen von wissenschaftlichen Publikationen daran orientieren.
Die wichtigsten Grundsätze im Hinblick auf das wissenschaftliche Publizieren sind im ersten Paragraphen des Regelwerks formuliert. Sie lassen sich auf die folgenden Schlagworte verkürzen:
- sorgfältig und angemessen (lege artis) arbeiten
- Forschungsresultate dokumentieren
- Ergebnisse kritisch hinterfragen
- Beiträge anderer Personen klar kennzeichnen (ordentlich zitieren)
- korrektes Aufführen aller beteiligten Autoren und Autorinnen
Richtlinien der LMU zur Selbstkontrolle in der Wissenschaft (118 KB)nach oben
Vorgaben der Fachdisziplinen
Die konkreten Ausführungsbestimmungen für die Abfassung von wissenschaftlichen Arbeiten richten sich nach den Gepflogenheiten der jeweiligen Fachdisziplin. Daher ist es sehr wichtig, sich bei der Vorbereitung einer wissenschaftlichen Publikation über die geltenden Anforderungen des entsprechenden Fachs zu informieren. Die folgenden Informationsmöglichkeiten zum Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten sind insbesondere für Studierende oder Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler mit wenig Publikationserfahrung zu empfehlen:
- auf der Lehrstuhl- oder Fakultätshomepage sowie Auskünfte Ihres Betreuers bzw. Ihrer Betreuerin
- auf der Website oder in Publikationen von einschlägigen wissenschaftlichen Fachgesellschaften
- Literatur zum wissenschaftlichen Arbeiten für das jeweilige Fachnach oben
Literatur zum wissenschaftlichen Arbeiten
Die in der UB vorhandene Literatur zum wissenschaftlichen Arbeiten finden Sie im Online-Katalog unter dem Link:
Literatur zum wissenschaftlichen Arbeiten
Anschließend können Sie die angezeigten Titel nach bestimmten Kriterien (z.B. Erscheinungsjahr, Fach) einschränken.
Oder suchen Sie im Suchfeld unseres Online-Katalogs nach dem Begriff „wissenschaftliches Arbeiten” oder nach verwandten Begriffen und grenzen Sie die Ergebnisse ggf. auf Ihr Fach ein.nach oben
Systematische Literaturrecherche
Grundsätzlich steht am Anfang des wissenschaftlichen Arbeitens die systematische und möglichst umfassende Literaturrecherche. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass Ihre Arbeit an den aktuellen Forschungsstand anschließt und Sie nicht in den Verdacht des Plagiats kommen. Sie verhindern so, dass Sie Ergebnisse oder Überlegungen publizieren, die in ähnlicher Weise bereits veröffentlicht worden sind.
Wenn Sie Hinweise zur allgemeinen oder fachspezifischen Literaturrecherche bekommen möchten, bietet Ihnen die Webseite der UB verschiedene Möglichkeiten:
- Die Rubrik „fachspezifische Suchtipps”
- Fachspezifische Einführungen in die Literaturrecherche
- Allgemeine Einführungen in die Literaturrecherche
- E-Tutorials zu wichtigen Themen der Literaturrecherche
- Kontaktinformationen zu den fachlichen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern an der UB nach oben
Rechtlicher Rahmen
Urheberrechtsgesetz
Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst fallen unter die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes. Sie genießen einen gesetzlich festgelegten Schutz, sofern die Urheberin bzw. der Urheber nicht explizit andere Regelungen getroffen hat.
Sie können sich über Ihre Rechte als Urheberin bzw. Urheber sowie über die Möglichkeiten und Grenzen, Werke im Rahmen des Urheberrechtsgesetzes zu nutzen, im Wortlaut des Gesetzes informieren.
Vollständiger Text des Urheberrechtsgesetzes mit Versionsangabe
Am 26. Juni 2013 hat der Bundestag eine Novelle zum Urheberrechtsgesetz (UrhG) auf den Weg gebracht. Diese Novelle bezieht sich auf § 38 (4) UrhG und ist zum 1. Januar 2014 in Kraft getreten. Dieses neue Recht wird als Zweitveröffentlichungsrecht bezeichnet.
Die Schwerpunktinitiative „Digitale Information” der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen hat zu dieser Novelle eine Aufstellung von „Frequently Asked Questions” (FAQ) erstellt, um die Diskussion auch für juristische Laien aufzuarbeiten und die Anwendung des Rechts zu erleichtern.
FAQ zum Zweitveröffentlichungsrecht (334 KB)
Open-Content-Lizenzen
Die Namensnennung des Urhebers bzw. der Urheberin ist im deutschen Rechtsraum ein bedingungsloses Recht. Jedoch darf man als Urheber bzw. Urheberin Regelungen für die Verwertung des Werkes treffen, die liberaler sind als die Regelungen des Urheberrechtsgesetzes.
Im Rahmen der Open Access-Bewegung haben sich für wissenschaftliche Publikationen wie auch für andere Werke des geistigen Eigentums verschiedene Lizenzmodelle etabliert. Diese ermöglichen es dem Urheber bzw. der Urheberin, je nach Wunsch bestimmte Bearbeitungs-, Verwertungs- und Nutzungsrechte zu gestatten. Das bekannteste und meistgenutzte Open-Content-Modell ist Creative-Commons.
Deutsche Website Creative Commons
Praxisleitfaden zur Nutzung von Creative-Commons-Lizenzen (2,29 MB)
Plagiarismus
Plagiarismus in der Wissenschaftsgemeinschaft ist seit einigen Jahren ein vieldiskutiertes Thema. Um Plagiatsvorwürfe zu vermeiden, beachten Sie die Regelungen der guten wissenschaftlichen Praxis. Informieren Sie sich über spezifische Vorgaben zum wissenschaftlichen Arbeiten in Ihrer Fachdisziplin.
Wenn Sie sich unsicher sind, ob Sie alle Regelungen korrekt beachtet haben, wenden Sie sich an den Betreuer oder die Betreuerin Ihrer wissenschaftlichen Arbeit oder an einen Fachkollegen bzw. eine Fachkollegin.